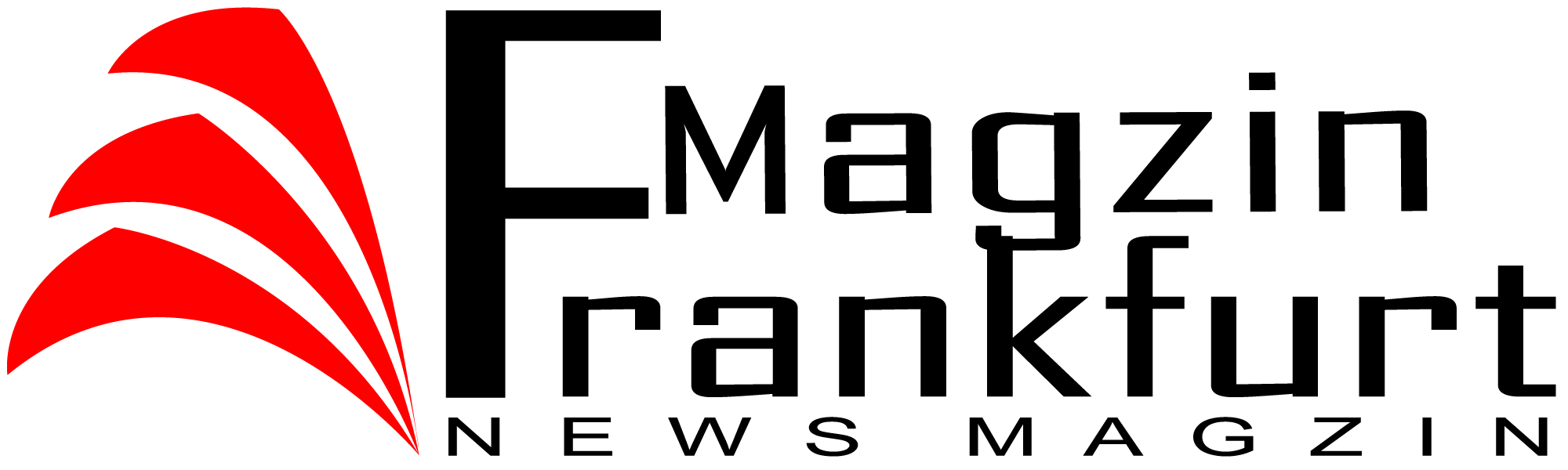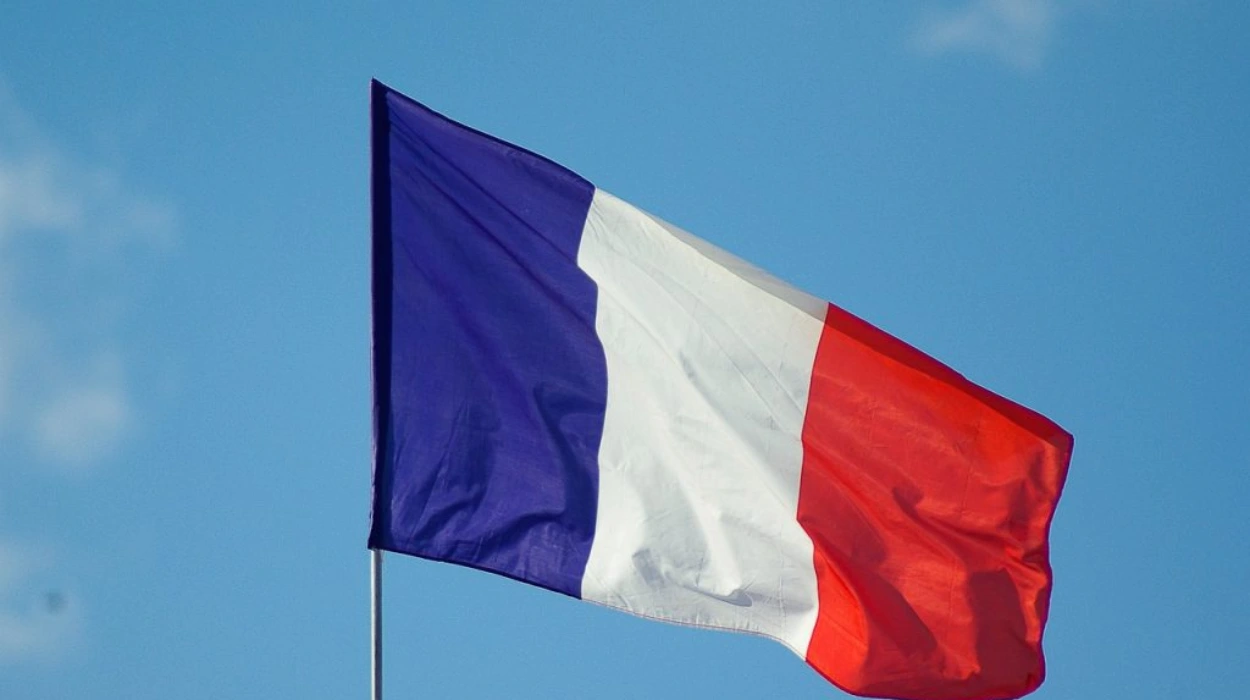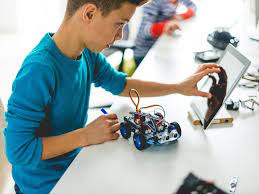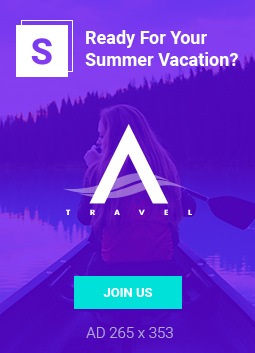Wenn einem bei einer Wanderung am Hohen Meißner der Geruch fauler Eier in die Nase steigt, dann ist die „Stinksteinwand“ nicht mehr weit. Seit Jahrhunderten schon glimmt in der ehemaligen Tagebauwand Kalbe am Osthang des höchsten Berges in Nordosthessen Braunkohle. „Namensgebend für die Wand sind die dabei entstehenden Schwefelgase, die aus den Flözen im Untergrund durch Bodenspalten nach außen dringen“, sagt Diethard Lindner vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, in dem der Hohe Meißner liegt.
Unter der Basaltdecke des Berges im Werra-Meißner-Kreis liegt ein bis zu 60 Meter mächtiges Braunkohleflöz, das zunächst untertägig und später auch im Tagebaubetrieb abgebaut wurde.
Kohle kann sich selbst entzünden
„Die Kohle enthält Markasit, ein Mineral, das in Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit zerfällt. Dabei wird so viel Oxidationswärme freigesetzt, dass sich die Kohle selbst entzünden kann“, erklärt Lindner das Phänomen des Flözbrandes. Bei bestimmten Wetterlagen sei der Schwefelgeruch auch hunderte Meter weit entfernt wahrnehmbar, berichtet der Geologe. Manchmal könne man auch Rauchschwaden aus der Stinksteinwand aufsteigen sehen.
Die Brände in dem sagenumwobenen Bergmassiv – Frau Holle soll dort gewirkt haben – schwelen bereits seit mindestens 400 Jahren. Schon seit ab 1578 am Osthang des Hohen Meißners Bergbau betrieben wurde, habe man versucht, sie durch das Abmauern der Stollen zu löschen, weiß Lindner zu berichten. 1929 wurde der Kohleabbau am Meißner eingestellt, nach dem Zweiten Weltkrieg im Tagebau wieder aufgenommen und 1974 endgültig beendet. 9,5 Millionen Tonnen Braunkohle wurden in dieser Zeit insgesamt gewonnen. Nach dem Ende des Abbaus wurde die Lagerstätte mit Abraum abgedeckt.
Das verhindert aber nicht, dass die Kohle weiter schwelt. Die Brände seien nicht zu löschen, sagt Matthias Dumm, Leiter des den Meißner betreuenden Forstamtes Hessisch Lichtenau. „Dieser Bereich des Hohen Meißners ist durchsetzt von zahlreichen alten Stollen, die seit dem 16. Jahrhundert in den Berg getrieben wurden und heute nicht mehr zugänglich sind. Dadurch ist der Berg zerklüftet, so dass Luft und damit Sauerstoff zirkulieren kann, was den Brand immer wieder anfacht“, erklärt er.
Brände auf vielen Quadratkilometern
Flözbrände kämen in Kohleabbaugebieten gar nicht so selten vor. „Die meisten derzeit in China, den USA und in Australien“, erläutert Dumm. Dort handele es sich jedoch meist um wesentlich größere Brände, die sich zum Teil auf viele Quadratkilometer erstreckten. Dagegen sei das Phänomen an der Stinksteinwand auf ein sehr kleines Areal beschränkt. „Ich schätze die Gesamtgröße des unterirdischen Bereiches, in dem es am Meißner vermutlich an verschiedenen kleineren Stellen schwelt auf maximal 10.000 Quadratmeter.“
Der Bereich um die Wand ist abgesperrt, sein Betreten verboten. Besucht werden darf er nur bei geführten Wanderungen des Geo-Naturparks. Denn es besteht die Gefahr, dass ausgebrannte Hohlräume einbrechen. So passiert 2001: Damals entdeckte ein Jogger große Rauchschwaden über dem Osthang. Die freigelegte bis zu 1000 Grad heiße Glut nahe der Oberfläche drohte, einen Waldbrand zu entfachen. Bäume wurden gerodet und die Höhlungen und Bergspalten, die das unterirdische Feuer wie ein Kamin anfachten, mit 150 Lastwagenladungen Erde zugedeckt.
Damit sei es gelungen, die Rauchentwicklung wieder auf das Maß zu reduzieren, das seit Jahrhunderten bestehe, sagt Dumm. Die Brandgase treten weiterhin aus. Eine seinerzeit durchgeführte Gefährdungsabschätzung habe ergeben, dass sie bereits unmittelbar über der Austrittsstelle so stark verdünnt sind, dass eine Gefährdung von Personen unwahrscheinlich sei, erläutert der Forstamtsleiter.
Lebensgefahr geht aber von drohenden Hangrutschen aus. „Die Basaltwand ist fragil. Der Berg ist in Bewegung“, erklärt Geologe Lindner. „Eine natürliche Folge des Bergbaus, gefördert durch Wasser im Hang.“ Immer wieder lösten sich Brocken und rutschten ab. Das Geröllmeer am Fuß der Wand zeugt davon.
Mehrere Erdrutsche
„Zum einen kommt es seit Jahrtausenden am Rand der überdeckenden Basaltplatte zu Erosionen und Abbrüchen, zum anderen war der Meißner über 450 Jahre Bergbaugebiet“, erläutert Dumm. „Es wurden nicht nur Stollen angelegt, sondern auch Abraumhalden aufgeschüttet, die von vornherein nicht die Stabilität natürlicher geologischer Strukturen aufwiesen.“ Bei näheren Untersuchungen in den letzten Jahren seien im Bereich der alten Bergbausiedlung Schwalbenthal unterhalb des Massivs Hangbewegungen festgestellt worden, berichtet Dumm. Derzeit werde ein Konzept zur Stabilisierung erarbeitet.
Schon früher ist der Berg abgerutscht. Nach einem Erdrutsch 1907 musste das Bergarbeiterdorf Schwalbenthal abgerissen werden, da die Häuser einsturzgefährdet waren. Allein das ehemalige Bergamt und spätere Gasthaus Schwalbenthal überstand den Vorfall. Seit 2010 ist das Lokal allerdings geschlossen, weil es dem Druck des Bergs kaum mehr standhält. 1988 kam es abermals zu einem Erdrutsch, der ein unterhalb des Schwalbenthals liegendes Skiheim stark beschädigte.