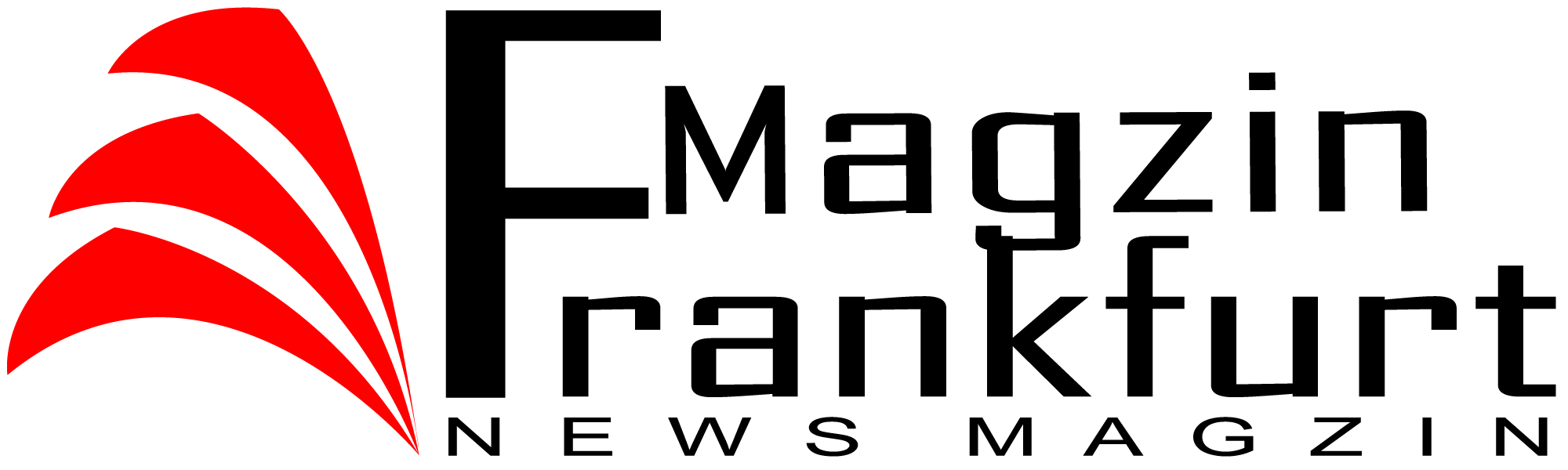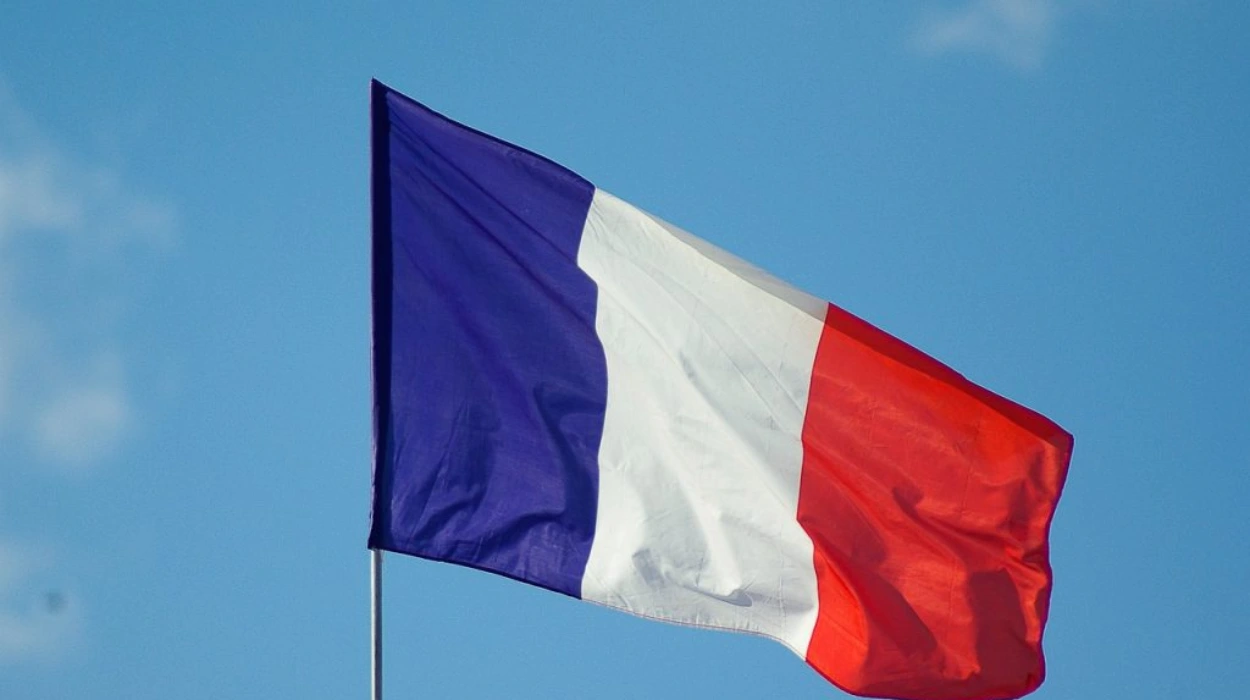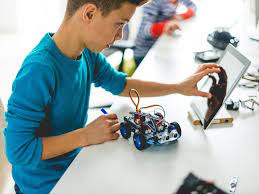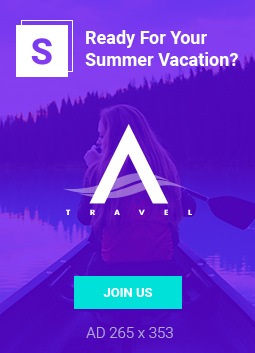Es war nicht leicht, Karl Heinz Bohrer eine Bemerkung zu seiner Methode zu entlocken. Zu fremd war ihm die Vorstellung, das wissenschaftliche Denken verdiene mit gleicher Gründlichkeit untersucht zu werden wie die Werke der Kunst. Als er sich dann aber doch bereitfand, auf einem Kolloquium zur „Philologischen Frage“ genau hierüber Auskunft zu geben, und seinen Vortrag über „Behaupten und Zeigen“ gerade beendet hatte, entfuhr dem damaligen verantwortlichen Redakteur für Geisteswissenschaften dieser Zeitung, Henning Ritter, im Publikum ein gewaltiger Seufzer: Da hatte einer wie im Kampf der Giganten die olympischen Götter zu entthronen versucht.
Bohrers Angriffslust machte vor nichts und niemandem halt. Reihenweise purzelten die Kolosse der Literatur- und Kulturtheorie von ihren Podesten: erst Hegel, dann Freud, Benjamin und Heidegger, dann Jauß, Greenblatt und Foucault. Sie alle verfehlten – so Bohrer – die Aufgabe der Kunst- und Literaturwissenschaft, indem sie, von problematischen Setzungen ausgehend, den Kunstcharakter der Werke eher verdunkelten als erhellten. „Reduktionismus“ lautete der Vorwurf, wenn Geschichte, Machtanalyse und Funktionalität so über den ästhetischen Ausdruck schierer Gegenwart triumphierten.
Um das Zeigen also geht es, das Behaupten dagegen rechnet Bohrer nur zu den Medien der Philosophie, der noch nie geschadet hat, was der Philologie, wenn sie sich von den Texten entfernt, sofort auf die Füße fällt. Dabei sind Setzungen (und Behauptungen sind im Kern Setzungen) der Bohrerschen Philologie nicht fremd. Sie gehören sogar zu ihren besonderen Stärken. Im Begriff der Intuition verbinden sich die scheinbar unverträglichen Vorstellungen von Setzen und Zeigen. Gezeigt wird auf etwas, von dem man sich sogleich fragt, wie es denn an den Ort gekommen sei, an dem man auf es zeigen kann. Das ist nichts weniger als ein Taschentrick. Es hat mit der komplizierten Topographie des ästhetischen Urteils zu tun, die Karl Heinz Bohrer selbst in seinen Studien zur „Plötzlichkeit“ (Frankfurt am Main 1981) völlig neu perspektiviert. Dort spricht er in seiner Abrechnung mit der „analytischen Illusion“ über den Vorsprung, den das avancierte ästhetische vor dem bloß historischen Bewusstsein hat. Nur so sind Fortschritt und Innovation, nur so, darf man folgern, ist auch philologische Erkenntnis möglich.
Ruf zur Attacke in Gestalt der Antithese
Nichts also wäre falscher als die Annahme, Bohrer habe sich nicht um die methodologischen Implikationen der Erklärung von Kunst und Literatur gekümmert. Was die Beschreibung der Bohrerschen Methode erschwert, ist das Fehlen einer festen Beobachterbasis in seinen Texten: Die Position des Betrachters hat sich so weit in den Gegenstand der Beobachtung hinein verschoben, dass beide Bereiche nicht mehr klar zu trennen sind. Einige Malereien des Surrealismus (etwa René Magrittes Mann mit oder im Vogelkäfig, genannt „Der Therapeut“, von 1937) könnten demonstrieren, wie sehr Betrachter und Gegenstand, Subjekt und Objekt zuweilen miteinander verwoben sind. Bohrer sitzt immer schon am Saum des Feldes, in dem die Dinge der Kunst sich formieren.